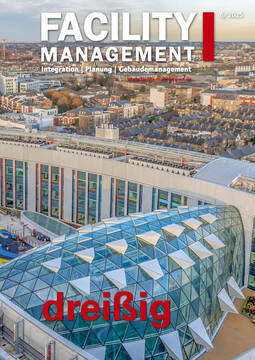Urban Facility Management: Vom Gebäude zur Stadt
ESG und Net Zero, knappe Budgets und trotzdem Lebensqualität für die Bewohner: Städte müssen mehr mit weniger erreichen. Dabei kann das Urban Facility Management (UFM) helfen, denn es überträgt die FM-Prinzipien wie Lebenszyklusdenken, SLA und KPI-Steuerung sowie Datenplattformen auf Straßen, Plätze, Parks, Beleuchtung und Stadtmöbel – und schließt damit die Lücke zwischen klassischem FM, kommunaler Daseinsvorsorge und Smart-City-Programmen.
Urbane Räume sind komplexe Systeme. Doch was für einzelne Gebäude längst Standard ist – klare Verantwortungen, definierte Service Levels, digitale Transparenz – fehlt im öffentlichen Raum oft noch. Urban Facility Management (UFM) setzt genau hier an: Aus einzelnen Bereichen wie Straßen, Plätzen, Grünflächen, Beleuchtung, Stadtmöbel und anderen ausgewählten Infrastrukturen wird mit Urban FM das zusammenhängende „Asset-Portfolio“ einer Stadt. An die Stelle von verstreuten Einzelgewerken tritt eine integrierte Betriebslogik mit eindeutigen Zielen: Aufenthaltsqualität, Sicherheit, Sauberkeit, Barrierefreiheit und Klimawirkung. Für Facility- und Immobilienmanager ist UFM damit die konsequente Erweiterung bekannter FM-Methoden, nur eben vom Objekt auf das Quartier oder die ganze Stadt.
Statt Leistungen ausschließlich über Stunden und Positionen zu beauftragen, werden Outputs definiert – etwa Sauberkeitsgrade, Reaktionszeiten, Verfügbarkeiten und Energiekennzahlen. Diese Zielgrößen werden in Performance-Verträgen fixiert und über digitale Plattformen laufend gemessen. IoT-Sensorik (z. B. Füllstände, Störungen, Lichtausfälle), GIS-gestützte Asset-Register und Meldungen aus Bürger-Apps laufen in einem gemeinsamen Ticket- und Reporting-System zusammen.
Aus Sicht der Steuerung entsteht so ein kontinuierlicher Regelkreis:
Messen – Bewerten – Intervenieren –
Lernen.
Das Ergebnis sind nachvollziehbare Entscheidungen, messbare Qualität und transparente Budgets – eine Sprache, die Vergabestellen, Dienstleister und Politik gleichermaßen verstehen.
Im Unterschied zum klassischen FM sind die Stakeholder im UFM vielfältiger. Neben dem Auftraggeber (meist der Kommune) spielen Fachämter, Stadtwerke, Verkehrsbetriebe, private Eigentümer und die Zivilgesellschaft eine Rolle. Durch UFM kann Governance-Klarheit geschaffen werden:
Wer ist für welche Asset-Klasse zuständig?
Welche KPIs gelten wo?
Wie greifen Leistungen an Schnittstellen ineinander (z. B. Reinigung – Grünpflege – Stadtmöbel)?
Denn dies ist die Voraussetzung, um Gewerke zu bündeln, Doppelarbeiten zu vermeiden und Reaktionszeiten zu verkürzen. Für Dienstleister eröffnet sich die Chance, multidisziplinäre Bundles anzubieten – etwa die Kombinationen aus Reinigung, Grünpflege, Kleinreparaturen, Beleuchtung oder Stadtmöbel-Management – und sie können ihre Qualität über Ergebniskennzahlen statt über Input nachweisen.
Ein zentrales Feld ist u. a. die öffentliche Beleuchtung: LED-Umrüstungen, intelligente Steuerung und systematische Instandhaltung senken Energieverbrauch und CO₂, verbessern gleichzeitig Sicherheit und Aufenthaltsqualität. Ähnlich hohe Hebel liegen in der Abfalllogistik: So können schon optimierte Routen für niedrigere Kosten sorgen. Und auch die Einführung von Unterflur- bzw. Vakuumsystemen und entsprechender Sensorik kann hier zur Optimierung beitragen. Schließlich liegen auch in der grünen Infrastruktur Potenziale, etwa wenn pflegeleichte, biodiversitätsfreundliche Bepflanzungen angelegt werden oder klimaresiliente Baumkonzepte umgesetzt werden. Doch überall gilt: Ohne eine solide Datenbasis – also die genaue Bestandsaufnahme, Zustandsklassen und Lebenszykluskosten – bleibt die Wirkung aus und Einsparungen sind eher Zufall. UFM übersetzt diese Daten in handhabbare KPIs und macht Fortschritt sichtbar: Von kWh pro Lichtpunkt über die mittlere Störungsbehebungszeit bis zum Sauberkeitsindex pro Teilraum.
Wie sieht das in der Praxis aus?
Die Stadt Barcelona beispielsweise hat mit „Cuidem Barcelona“ einen stadtweiten Pflege- und Reinigungsrahmen geschaffen, der bezirksspezifisch umgesetzt und zentral gesteuert wird. Dahinter stehen klare Qualitätsniveaus und ein gutes Monitoring, das Ressourcen dorthin lenkt, wo sie den größten Effekt haben Aber auch die Bürgerkommunikation ist von großer Bedeutung – getreu dem Motto „tue Gutes und sprich darüber“. Im Metropolraum Barcelona zeigen performancebasierte Verkehrs‑Erhaltungsverträge, wie netzweite Output-KPIs (Zustand, Sicherheit, Reisezeiten) auch im öffentlichen Raum funktionieren.
Auch in Freiburg wurden FM-Strukturen für kommunale Gebäude so zentralisiert, dass Entscheidungen über Sanierung und Neubau daten- und lebenszyklusgetrieben getroffen werden – ein Vorbild für die Verzahnung von FM und städtischer Nachhaltigkeitssteuerung.
Und ganz oben im Norden Europas ist die Stadt Trondheim ebenfalls ein gutes Beispiel für die Umsetzung des UFM, denn hier ist die UFM-Logik bereits in der Stadtplanung selbst fest verankert. Das bedeutet zum Beispiel, dass für neue Quartiere Schwellenwerte gelten, ab denen pneumatische Unterflur‑Abfalllösungen verpflichtend sind. Denn so sinkt der Lkw‑Sammelverkehr, Flächen bleiben sauberer und der Betrieb ist besser planbar.
Parallel arbeitet Trondheim mit der Norwegian University of Science and Technology (NTNU) und verschiedenen europäischen Programmen wie etwa dem Smart Cities Marketplace an der digitalen Transformation der Infrastruktursteuerung. Sensorik, GIS und Ticketing fließen hier in eine integrierte Plattform, auf deren Basis SLA‑Reviews und Bonus/Malus‑Mechanismen gesteuert werden. Urban Facility Management fungiert also als Betriebslogik der Smart City – Standards im Plan, Messung im Betrieb, Lernen im Regelkreis.
Für Kommunen bedeutet der Schritt ins UFM nicht zwangsläufig eine Großreform. Oft reicht ein Pilot in zwei Bezirken: Leistungsbündel schnüren, Baseline messen, Output‑KPIs definieren und digitale Werkzeuge pragmatisch einsetzen. Wichtig ist, früh die Schnittstellen zwischen Ämtern und Dienstleistern zu klären und Datenflüsse verbindlich zu regeln. Für Corporate‑FM und Immobilienmanager lohnt der Blick auf den eigenen Campus: Viele Unternehmensareale sind „kleine Städte“. Wer dort UFM-Prinzipien anwendet – etwa Aufenthaltsqualität als KPI, integrierte Services und digitale Meldesysteme – steigert Nutzerzufriedenheit, Sicherheit und ESG‑Wirkung. Serviceanbieter wiederum gewinnen, wenn sie Digitalisierungskompetenz (IoT, GIS, Reporting) aufbauen und Ergebnisse transparent belegen: Wirkung statt Input.
Fazit
Beschaffung ist der Hebel, der alles miteinander verbindet. Moderne Vergaben nutzen Green‑Public‑Procurement‑Kriterien und schreiben Performance statt reiner Positionslisten aus. Bewertet werden dann nicht nur Preise, sondern auch Qualitäts‑ und ESG‑Beiträge, Innovationsansätze und Reporting‑Fähigkeit. Damit schafft UFM die Voraussetzung, öffentliche Räume als „kritische Infrastruktur der Lebensqualität“ zu behandeln – mit der gleichen Professionalität, die wir aus dem Gebäudebetrieb kennen.
So professionalisiert das Urban Facility Management nicht nur die Bewirtschaftung des öffentlichen Raums, vielmehr liefert es eine gemeinsame Sprache für Politik, Verwaltung und Dienstleister, macht Qualität sichtbar und beschleunigt Verbesserungen dort, wo Menschen sie täglich erleben – auf dem Gehweg, im Park um die Ecke, auf der beleuchteten Route nach Hause.
Was ist Urban Facility Management?
Urban Facility Management (UFM) ist eine Erweiterung des klassischen Facility Managements, die sich nicht auf einzelne Gebäude, sondern auf die Verwaltung und Optimierung der Dienstleistungen und Prozesse in gesamten städtischen Gebieten konzentriert. Es integriert das Management von Infrastruktur, öffentlichen Räumen, Energie, Abfall und Sicherheit über den gesamten Lebenszyklus einer Stadt, oft unterstützt durch Technologie und digitale Plattformen über klare Service Levels und Output-KPIs, um die Lebensqualität für Bewohner zu verbessern.
Leistungsfelder (Beispiele):
Reinigung & Abfalllogistik (inkl. Unterflur-/Vakuumsysteme)
Grünpflege & Biodiversität (Parks, Straßenbäume, Pocket Parks)
Öffentliche Beleuchtung (Energie, Verfügbarkeit, Störungsmanagement)
Stadtmöbel/Spielgeräte, Kleinreparaturen, Winterdienst
Monitoring & Meldemanagement (IoT, Füllstände, Ausfälle; Bürger-App)
Daten/Asset-Register (GIS, CMMS/CAFM), Berichtswesen
Merkmale des Urban Facility Management
Umfassender städtischer Ansatz: UFM betrachtet die Stadt als Ganzes und nicht nur einzelne Gebäude oder Komplexe.
Integriertes Service-Management: Es koordiniert eine Vielzahl von Dienstleistungen wie Reinigung, Winterdienst, Instandhaltung, Reparaturen und Grünpflege über öffentliche Räume hinweg.
Steuerung durch Technologie: Moderne Technologien wie die Erfassung von Daten und die Nutzung von Smart-City-Plattformen sind entscheidend, um Prozesse zu optimieren, die Entscheidungsfindung zu unterstützen und die Effizienz zu steigern.
Lebensqualität verbessern: Ein zentrales Ziel ist die Steigerung der Lebensqualität durch die Gewährleistung von Sicherheit, Zugang, funktionierender Infrastruktur und sozialer Kohäsion.
Koordination und Vermittlung: UFM fungiert als Vermittler zwischen öffentlichen, privaten und bürgerlichen Akteuren, um die Bedürfnisse verschiedener Nutzergruppen zu koordinieren.
Schwerpunkt Nachhaltigkeit: Ein wichtiger Aspekt ist die Überwachung und Verbesserung von Energie-, Wasser- und Abfallmanagement in öffentlichen Bereichen, um die Nachhaltigkeit der Stadt zu fördern.
Effizienz und Kosteneinsparungen: Durch die Bündelung und Optimierung von Dienstleistungen können Kosten gesenkt und die Effizienz gesteigert werden, beispielsweise durch die Vermeidung von Doppelarbeit und die bessere Nutzung von Ressourcen.
Beispiele gelungener Umsetzung
Barcelona – "Cuidem Barcelona": Stadtweiter Pflege- und Reinigungsplan für Straßen/Plätze/Parks (Invest ~70 Mio. €), kombiniert mit neuen Reinigungsverträgen und Zero‑Waste‑Zielen; Umsetzung je Bezirk, zentrale KPI/SLA‑Steuerung, Bürgerkommunikation.
Metropolregion Barcelona – Performance‑basierte Instandhaltung: Netzweite, output‑orientierte Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur (Zustand, Sicherheit, Reisezeit) als Blaupause für öffentliche Raumservices.
Freiburg i. Br. – Zentrales kommunales FM: Portfolio‑Daten als Grundlage für nachhaltige Sanierungs-/Neubauentscheidungen; Integration von Energie- und Lebenszykluszielen.
Trondheim – Smart‑City‑getriebene UFM‑Bausteine: Von pneumatischer Unterflur‑Abfalllogistik mit verbindlichen Schwellenwerten bis zu EU‑Programmen für klimaneutrale Städte; starke Verknüpfung mit NTNU‑Forschung und Bürgerbeteiligung.