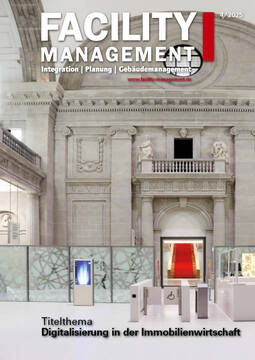„Bauen oder Nicht-Bauen, das ist hier die Frage“
Genau diese Frage wird auf der diesjährigen Architektur-Biennale in Venedig unter anderem gestellt: „Bauen oder nicht Bauen, das ist hier die Frage.“ Ernst genommen sprengt sie diese Ausstellung. Denn die Bauwirtschaft mit ihrem exorbitanten CO2-Ausstoß muss sich reglementieren! Oder ist ein globaler Baustopp die logische Konsequenz?
Mit rund 45 Mio. t CO2-Äquivalenten im Jahr 2020 tragen die heute im Hochbauwesen verwendeten Baustoffe deutlich zu den Treibhausgas-Emissionen von Deutschland bei. Da der Emissionsausstoß im Bauwesen aufgrund der zunehmenden Bautätigkeit und der notwendigen Sanierungsmaßnahmen weiter ansteigen wird, spielt er nicht nur auf der sektorspezifischen Ebene eine größere Rolle, sondern auf der gesamten Bundestreibhausgasebene. Bisherige Einsparungen haben sich nahezu ausschließlich auf den Energieverbrauch während des Gebäudebetriebs konzentriert. Der prozentuale Anteil der Baustoffemissionen an den gesamten Treibhausgas-Emissionen nimmt durch die steigende Effizienzsteigerung im Energie- und Wärmesektor seit 2016 kontinuierlich zu.
Vor diesem Hintergrund sind wir als Planer aufgefordert, für eine veränderte Welt zu entwerfen. Viel klüger wäre es, sich auf das Abenteuer namens Umbau einzulassen und bereits Bestehendes an die neuen Realitäten anzupassen.
Das Facility Management kann durch die Optimierung der genutzten Flächen seinen Beitrag dazu leisten. Wie hoch der Beitrag sein kann, wird häufig unterschätzt, denn in den wenigsten Unternehmen sind die tatsächlichen Potentiale der Verwaltungsflächen bekannt. Dies zeigt sich im Besonderen, wenn die Flächen ergebnisoffen untersucht werden. Dafür bräuchte es eine andere Herangehensweise an die Themen der konzeptionellen Arbeitsplatzgestaltung mit einer größeren Anzahl von gemeinsam genutzten Flächen in horizontalen als auch in vertikalen Hierarchien.
Es ist also eine Frage der Suffizienz: „Wie viel ist genug?“ und zielt darauf ab, Energie und Material zu sparen. Solche Ansätze weiterzudenken und zu entwickeln, wäre weit radikaler, als von Robotik und KI-Lösungen zu träumen.
Auf Büroobjekte übertragen bedeutet es, dass die vorhandenen Flächen effizient genutzt werden und die Planungen nicht von aktuellen Strömungen geleitet werden. Erst wenn es gelingt die Umweltverträglichkeit durch Substitution und Recycling in den Vordergrund zu stellen, findet ein Umdenken im Gebäudesektor statt. Beispiele aus unserer Praxis zeigen, dass Flächen-Effizienzsteigerungen bis zu 60% in Bestandsgebäuden möglich sind. Die Kosten der Anpassungsmaßnahmen sind überschaubar und stehen in keiner Relation zu den Einsparungen bei der Flächenbewirtschaftung und den Einsparungen beim CO2-Ausstoß gegenüber einem Neubau.
Und das Fazit: Um Verknappung und Übernutzung von Ressourcen etwas entgegenzusetzen und die Treibhausgas-Emissionen durch den Bausektor zu verringern, muss zirkulär geplant und gebaut werden, sowie Gebäude als Rohstofflager genutzt werden.
Unter dieser Prämisse stehen die Sanierung und Nutzung der Bestandsgebäude an oberster Stelle. Wir Planer stellen uns der Herausforderung, durch nachhaltiges und kreislauffähiges Bauen unseren Beitrag zur CO2-Reduktion zu leisten.