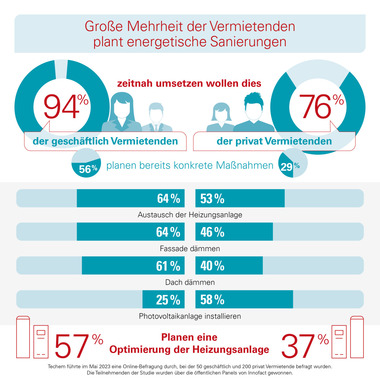Effizienz steigern und Emissionen senken
In vielen deutschen Gebäuden sind Heizungssysteme ineffizient eingestellt – unabhängig vom Alter der Anlage. Tatsächlich arbeitet nur etwa jede fünfte Heizung optimal. Die Folgen sind hohe Energieverbräuche und CO2-Emissionen sowie vermeidbare Betriebskosten. KI-basierte Lösungen bieten Abhilfe, indem sie den Heizungsbetrieb optimieren und die Energieeffizienz signifikant steigern.
Etwa 80 % aller Heizungsanlagen in deutschen Mehrfamilienhäusern sind überdimensioniert und falsch eingestellt.[1] Und auch in vielen anderen Immobilien läuft die Heizung rund um die Uhr und den Sommer hindurch – unabhängig vom tatsächlichen Bedarf. Das kann im Übrigen auch für energetisch gut sanierte Gebäude gelten. Die Folgen einer ineffizienten und ggf. sogar überdimensionierten Heizungsanlage sind indes gravierend:
Hohe Energieverbräuche führen zu hohen Betriebskosten.
Insbesondere Wohnungsbaugesellschaften können weder die gesetzlichen Vorgaben noch die selbst gesetzten Nachhaltigkeitsziele einhalten.
Immobilien mit schlechter Energieeffizienz verlieren rasch an Attraktivität – sowohl bei Mietern als auch bei Investoren.
Für Immobilienbesitzer besteht daher Handlungsbedarf. Um konkrete Optimierungspotenziale identifizieren und heben zu können, bedarf es smarter IoT-Lösungen, die eine umfassende Fernüberwachung von Heizungsanlagen ermöglichen.
Mit KI zu optimierten Lösungen
Der Digitale Heizungskeller von Techem liefert die smarte, geringinvestive Lösung für die genannten Herausforderungen, basierend auf unserer digitalen Plattform für alle Verbrauchsarten, die für eine neue Art steht, das Energie- und Gebäudemanagement zu denken. Mittels digitaler Sensorik und KI-basierter Fernanalyse werden fehlerhafte Einstellungen bei Heizungsanlagen leicht erkannt und entsprechende Optimierungshinweise gegeben. Die Sensoren, die direkt an der Heizungsanlage installiert werden, sind mit einem Gateway (Smart Reader Plus) gekoppelt. Dieses erfasst alle Temperatur- und Zählerdaten im Minutentakt und übermittelt sie verschlüsselt und sicher an eine zentralisierte Cloud – natürlich DSGVO-konform.
Das System erfasst detailliert alle relevanten Komponenten der Heizungsanlage, dokumentiert diese digital und hält sie mit Fotografien fest. Dies ermöglicht einen virtuellen Rundgang durch den Heizungskeller, ohne dass Techniker physisch vor Ort sein müssen. Liegt die komplette hydraulische Topologie vor, können Experten schnell fundierte Entscheidungen treffen. Künstliche Intelligenz, das Herzstück des Systems, analysiert die gesammelten Daten, wodurch konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet, auftretende Störungen frühzeitig erkannt und als Alarm weitergereicht werden. Das reduziert nicht nur Ausfallzeiten, sondern erhöht auch die Betriebssicherheit signifikant.
Den Energieverbrauch senken
So sind mit Hilfe von smarten, geringinvestiven Lösungen wie dem Digitalen Heizungskeller erhebliche Effizienzsteigerungen und eine Verbrauchsreduktion um durchschnittlich 15 % möglich. In einem Portfolio, das ausschließlich aus Wärmepumpensystemen besteht, kann auf diese Weise sogar eine durchschnittliche Reduktion des Energieverbrauchs um 27% realisiert werden.
Über ein webbasiertes Portal erhalten Nutzer zu jeder Zeit einen umfassenden Überblick über den Zustand ihrer Heizungsanlagen. Konkrete Handlungsempfehlungen sind auf Knopfdruck verfügbar, wobei jede Maßnahme direkt ausweist, welchen Effekt sie in Kilowattstunden, Euro oder CO2-Äquivalent hat.
Das System ist für alle Arten von Heizsystemen und Energieträgern geeignet. Auch klimaschonende Lösungen wie z. B. Solarthermie und Wärmepumpen können auf diese Weise noch energieeffizienter ausgerichtet werden. Mit der Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) gewinnt digitales Heizungsmonitoring weiter an Bedeutung. Die EU-Richtlinie zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden, die bis zum 29. Mai 2026 in deutsches Recht umgesetzt werden muss, sieht für Wohngebäude mit bestehenden Heizungsanlagen regelmäßige Inspektionen vor. Eine kontinuierliche Überwachung der Heizungsanlage könnte dabei als Alternative zu den vorgeschriebenen Inspektionen dienen. Im Neubau sowie nach größeren Renovierungen wird die kontinuierliche Überwachung der Systemeffizienz gar zur Pflicht.[2]
Gebäude als thermische Energiespeicher
Wer die Wärmebereitstellung noch präziser an den Bedarf der Mieter anpassen möchte, kann zukünftig auch Daten „oberhalb der Kellerdecke“ einbeziehen – zum Beispiel durch deren Erfassung über Heizkostenverteiler oder Multisensorgeräte, die nicht nur vor Rauch warnen, sondern auch Hitze, Kohlenmonoxid, Temperatur und Feuchtigkeit messen und datenschutzkonform in konkrete Handlungsempfehlungen überführen. Das auf diese Weise entstehende smarte Ökosystem eröffnet zusätzliche Optimierungspotenziale.
Der Digitale Heizungskeller spielt zudem eine Schlüsselrolle für zukünftig KI-gesteuerte und netzdienliche Wärmepumpenanlagen. Durch den Einsatz intelligenter Wärmepumpen lässt sich die Wärmeversorgung flexibel an das schwankende Angebot erneuerbarer Energien anpassen. Ist viel Wind- oder Solarstrom verfügbar, speichern Gebäude thermische Energie, während sie in Zeiten knapper Stromressourcen ihren Verbrauch reduzieren. Diese Kopplung von Strom- und Wärmenetzen verbessert die Netzauslastung, reduziert Emissionen und kann maßgeblich zur gesamtwirtschaftlichen Energieeffizienz beitragen. Ein solches Demand-Side-Management ermöglicht es zudem, Energieverbrauch gezielt zu steuern und damit Versorgungssicherheit und Netzstabilität in einer dezentralen Energiewelt zu gewährleisten. So wird der Digitale Heizungskeller ein entscheidender Baustein auf dem Weg zum klimaneutralen Gebäudebestand.